THE HOBBIT, J.R.R. Tolkien
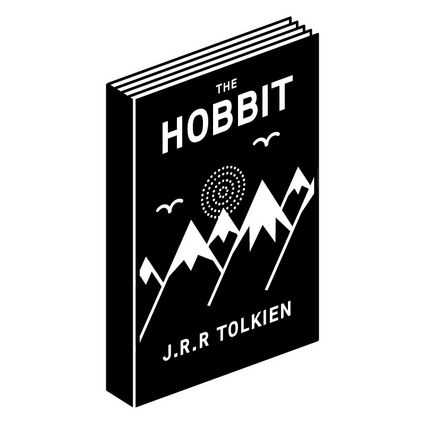
»In a hole in the ground there lived a hobbit.«
»Der kleine Hobbit« habe ich schon als Kind geliebt, und es war eine große Freude, es gemeinsam mit unseren Kindern zu lesen. Ich mag die fantasievollen Beschreibungen, die kindliche Naivität und märchenhafte Kreativität. Wenn man in das Buch eintaucht, beginnt man, die Welt wieder mit Kinderaugen zu sehen.
MATTHIAS BELLER, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Katalyse und Vizepräsident der Leibniz-Gemeinschaft
ZETTEL’S TRAUM, Arno Schmidt

»:’ - :king !’-«
Nicht ein Satz bildet den Anfang dieses Buchs, sondern ein Fluch oder das Geräusch eines Stacheldrahtzauns an einer Kuhweide in der Ostheide, an dem der Erzähler hängen bleibt. Oder ist es vielleicht eine Anspielung auf Shakespeares ›Sommernachtstraum‹? Mit diesem Textgebilde jedenfalls beginnt eines der ungewöhnlichsten Werke der modernen deutschen Literatur, das in einer hochkomplexen und zugleich sehr alltäglichen Sprache von Banalitäten wie diesem Spaziergang erzählt und damit seinen Figuren die Basis bildet für äußerst anspielungsreiche Gespräche zur Literaturgeschichte in der Manier von James Joyce.
HENNING LOBIN, Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache
DAS PARFUM, Patrick Süskind

»Im achtzehnten Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte.«
Dieser Satz stellt uns Jean-Baptiste Grenouille vor, dessen Genie und einziger Ehrgeiz sich auf ein Gebiet beschränkt: das flüchtige Reich der Gerüche. Süskinds Idee, in einem historischen Kriminalroman ein olfaktorisches Monster auf die Suche nach dem einen, unwiderstehlichen Duft zu schicken, hat mich von Anfang an fasziniert, auch aus beruflicher Sicht. Der vielschichtige Roman verdeutlicht, wie bedeutsam Gerüche und der Geruchssinn für zwischenmenschliche Beziehungen sind, wie sie unseren Alltag beeinflussen, uns unbewusst manipulieren.
VERONIKA SOMOZA, Direktorin des Leibniz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München
GAUDY NIGHT, Dorothy L. Sayers
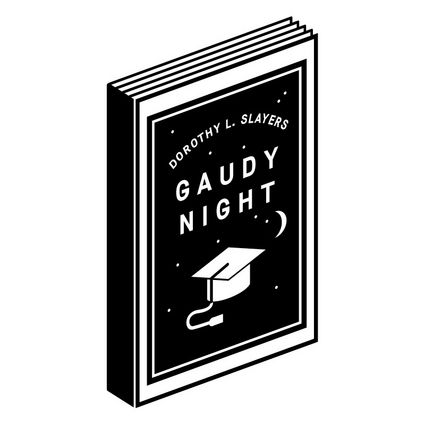
»Harriet Vane sat at her writing-table and stared out into Mecklenburg Square.«
Mich befördert dieser Satz unmittelbar in das Londoner Künstlerviertel Bloomsbury des letzten Jahrhunderts, mit seinen typischen Stadthäusern rund um kleine begrünte Plätze, in denen Schriftstellerinnen wie Virginia Woolf oder eben auch Dorothy Sayers selbst gelebt und gearbeitet haben. Der (untypische) Detektivroman zeichnet in liebevoll-scharfzüngiger Weise das Bild eines Frauencolleges in Oxford in den 1930er Jahren und ist für mich der beste Roman aus der unvergleichlichen Serie um Lord Peter Wimsey.
BETTINA BÖHM, Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft
NACHTZUG NACH LISSABON, Pascal Mercier

»Wir bestehen alle nur aus buntscheckigen Fetzen, die so locker und lose aneinanderhängen, daß jeder von ihnen jeden Augenblick flattert, wie er will; daher gibt es ebenso viele Unterschiede zwischen uns und uns selbst wie zwischen uns und den anderen.«
Dieser Satz gefällt mir, weil er die Buntheit und Vielfalt des Lebens so bildlich und präzise beschreibt. Und das nicht nur bezogen auf die Vielfalt gegenüber anderen, sondern auch bezogen auf die eigene Vielfalt und die vielen Unterschiede in uns selbst. Der Kern des Buchs liegt in der Idee, noch einmal an einem bestimmten Punkt des eigenen Lebens zu stehen und von dort aus einen ganz anderen Weg einschlagen zu können. Mich inspiriert der Gedanke, Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu hinterfragen.
KLAUS TOCHTERMANN, Direktor der ZBW — Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
DIE LETZTE WELT, Christoph Ransmayr

»Ein Orkan, das war ein Vogelschwarm hoch oben in der Nacht; ein weißer Schwarm, der rauschend näher kam und plötzlich nur noch die Krone einer ungeheuren Welle war, die auf das Schiff zusprang.«
Der Anfang des Romans beschreibt eine stürmische Seereise, auf für mich unvergessliche Weise. Der Roman beschäftigt sich mit dem römischen Dichter Ovid und seinen Metamorphosen sowie mit den Themen der Spurensuche, politischer Unterdrückung und Exil.
CLEMENS FUEST, Präsident des ifo Instituts, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
OUT OF AFRICA, Tania Blixen

»I had a farm in Africa, at the foot of the Ngong Hills.«
Ostafrika ist für mich ein Sehnsuchtsort; bei diesem Satzanfang öffnen sich in meinem Kopf all die Bilder, Erinnerungen, Gefühle, die ich mit Afrika verbinde. Das Buch ist komplexer, schwieriger als dieser erste Satz suggeriert. Tania Blixen kreiert unglaublich atmosphärische Bilder, aber ihre aristokratische, koloniale Perspektive auf Afrika finde ich befremdlich und unangemessen.
KATRIN BÖHNING-GAESE, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums und Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft
DIE NEW-YORK-TRILOGIE, Paul Auster

»Mit einer falschen Nummer fing es an, mitten in der Nacht läutete das Telefon dreimal, und die Stimme am anderen Ende fragte nach jemandem, der er nicht war.«
Das Buch handelt vom Spiel mit Identitäten, das der Satz wunderbar einleitet. Die Hauptfigur, Daniel Quinn, finanziert sein Leben als Autor von Kriminalromanen. Er schreibt unter dem Pseudonym William Wilson über den Privatdetektiv Max Work, der als Ich-Erzähler fungiert. Quinn bekommt Telefonanrufe von jemandem, der Paul Auster — den echten Erzähler — sprechen möchte. Im Lauf der Geschichte gibt er sich als Auster aus — und löst sich quasi auf. Übrig bleibt sein rotes Notizbuch, das Paul Auster findet.
ULRIKE CRESS, Direktorin des Leibniz- Instituts für Wissensmedien
WAS IST LEBEN?, Erwin Schrödinger

»Bei einem Mann der Wissenschaft darf man ein unmittelbares, durchdringendes und vollständiges Wissen in einem begrenzten Stoffgebiet voraussetzen, und darum erwartet man von ihm gewöhnlich, daß er von einem Thema, das er nicht beherrscht, die Finger läßt.«
»Dieser erste Satz des berühmten Quantenphysikers Erwin Schrödinger (›Schrödingergleichung‹) von 1944 zeugt vom Mut, in der Wissenschaft neue Wege zu gehen. Er könnte uns auch heute noch Ansporn sein, fachliche Grenzen zu überschreiten und das Risiko auf uns zu nehmen, einen anderen Blickwinkel zu wählen, um Probleme zu lösen, die aus der Enge einer Fachdisziplin heraus nicht zu lösen sind.«
WOLFGANG HECKL, Generaldirektor des Deutschen Museums, Leibniz-Forschungsmuseum
LA COMEDIA, Dante Alighieri

»Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren.«
Dieser Satz beschreibt das Szenario des Orientierungsverlustes, er könnte ein Schlusssatz sein. Es ist aber der Satz am Anfang, und damit verbunden ist die Botschaft: Auch wenn es eine lange, schwierige Wegstrecke von unbestimmter Dauer wird — der Weg muss (weiter)gegangen werden. Für mich ist dieser vor 700 Jahren geschriebene Anfang von staunenswerter, zeitloser Aktualität, in Worte gefasst in einem Anfangssatz aus sprachgewordener Musik.
SABINE BRÜNGER-WEILANDT, Direktorin des FIZ Karlsruhe — Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur
SALAMMBÔ, Gustave Flaubert
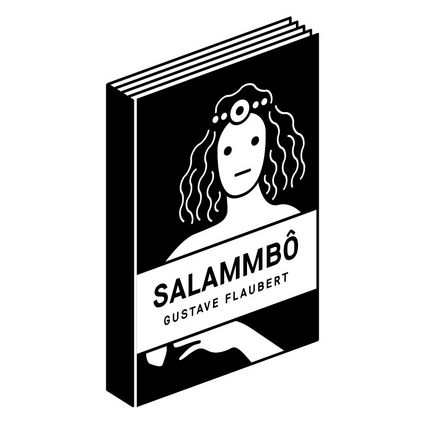
»C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.«
Die sprachliche Eleganz dieses Eingangssatzes lässt sich in der deutschen Übersetzung — etwa: »Es war in Megara, einer der Vorstädte Karthagos, in den Gärten Hamilkars« — nur unzureichend wiedergeben. Der Satz führt den Leser ganz unmittelbar in eine exotische, geheimnisvolle und versunkene Welt. Tatsächliche historische Hintergründe verknüpfen sich mit der überbordenden Beschreibung fiktiver Ereignisse. Der Roman strotzt vor Szenen exzessiver Gewalt, was schon zeitgenössisch auf Kritik stieß. Der Autor aber enthält sich jeder moralischen Wertung. Damit konfrontiert Flaubert die Gegenwart mit einem Spiegel. In ihm lässt sich erkennen, wie fragil die Grenzen sind zwischen Zivilisation und Gewalt, Religion und Fanatismus, Liebe und Tod.
ANDREAS WIRSCHING, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte München−Berlin
EIN KAPITEL AUS MEINEM LEBEN, Barbara Honigmann

»›Es war grausam, Ethel und Julius Rosenberg hinzurichten, aber unschuldig waren sie nicht‹, sagte meine Mutter, während sie vor dem Spiegel ihre wilde Frisur in irgendeine Ordnung zu bringen versuchte; und obwohl das, was sie da sagte, im Gegensatz zu allem stand, was ich um mich herum hörte, was sie in der Schule lehrten und wie es sonst überliefert wurde, ließ meine Mutter gar keinen Zweifel daran, daß sie es besser wußte, und deswegen fragte ich auch nicht nach.«
79 Worte enthält dieser erste Satz, der in einer rasanten Eile vom Kalten Krieg und seinen Zeitikonen über die Intimität einer Mutter-Kind-Beziehung führt, die Eitelkeit der Mutter streift, um zum Kern der familiären Verhältnisse zu gelangen, in Spannung zwischen Wahrheit und Lüge, vor allem aber durchdrungen von Geheimnissen, in der Welt einer jüdisch-kommunistischen Familie, ›privilegiert und ungeschützt‹ als Teil der Nomenklatura Ost-Berlins. Kann ein erster Satz mehr leisten?
YFAAT WEISS, Direktorin des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur — Simon Dubnow
EIN MORD DEN JEDER BEGEHT, Heimito von Doderer

»Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was darin war. Aber ein ganzes Leben lang rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln wie er will.«
Dieser Romananfang klingt erst einmal trostlos: Die eigene Kindheit gehört einem nicht, und man wird sie nicht los. Unter dem Eimer steht man wie ein dauerhaft begossener Pudel. Immerhin schafft der Umstand, dass ›jeder‹ so dasteht, eine gewisse Gemeinschaft, denn ›an uns‹ rinnt es herunter. Unwillkürlich fällt einem jener andere berühmte Eingangssatz von Tolstois Anna Karenina ein: ›Alle glücklichen Familien ähneln einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre Weise unglücklich.‹ Nur dass von Glück und Unglück bei Doderer gar nicht die Rede ist, weil sich erst später zeigt, was eigentlich im Eimer war. Gefallen hat mir immer die Verbuchstäblichung des Unent-rinn-baren im Bild der an uns herabrinnenden Flüssigkeit. Seine Komik passt eigentlich nicht zu den alten Vorstellungen vom starren Schicksal und auch nicht zu den jüngeren eines Determinismus.
EVA GEULEN, Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung



